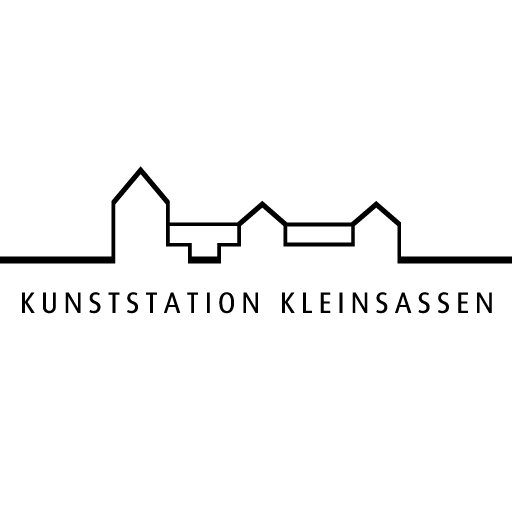von Kuratorin Dr. Elisabeth Heil
Licht – Raum – Dimension.
Gegenüber mittendrin.
Sich sammeln.
So lauten die Ausstellungstitel unserer diesjährigen Frühjahrsausstellungen.
Und wenn man die Worte hintereinander liest, entstehen in unserer Vorstellung schon Bilder.
Gegenüber mittendrin: Unser ganzes Leben lang befinden wir uns im Gegenüber zu irgendetwas – gegenüber Menschen, Gegenständen, Natur- und Architekturszenerien. Unser ganzes Leben befinden wir uns mittendrin – inmitten von Menschen, Gegenständen, Räumen, Natur, Licht. Gegenüber und mittendrin agieren wir, sammeln uns und sammeln unsere Erfahrungen.
Was und wie nehmen wir all das wahr? Eines ist sicher: Jeder tut es auf seine ganz eigene Weise. Denn was wir sehen und mit allen anderen Sinnen aufnehmen, ist sehr individuell und sehr selektiv.
Eine Fotografie mag einen Augenblick zu bannen. Und sieht man davon ab, dass der Fotograf einen bestimmten Ausschnitt der Welt zu einer bestimmten Zeit ausgewählt hat, so nimmt die Kamera doch alles innerhalb dieses Ausschnittes mit gleicher, ja gleichgültiger Akribie wahr. Merkwürdig ist, dass wir häufig bei unseren Fotos nicht den Eindruck haben, dass sie das wiedergeben, was wir doch eigentlich festhalten wollten. Wir sehen selektiv, fokussieren uns auf das uns Interessierende, schauen flüchtig über anderes hinweg. Überdies können Licht und Schatten manches überblenden und verdunkeln und unkenntlich machen. Das fließt in unsere Erinnerungen ein.
Emil Sorge bedient sich der Fotografien von Mega-Cities, Gebäuden und Naturimpressionen, die die Medien allseits verbreiten. Aber er reproduziert bzw. überträgt das Fotomotiv nicht detailverliebt in Malerei, sondern sieht sich im Gegenüber der Szenerie und übernimmt selektiv in Gouachen, was ihn fasziniert, was seine Augen an Strukturen, an Lichtsituationen, an Farbigkeit erfassen und wahrnehmen würden, wäre er selbst vor Ort gewesen. Anderes bleibt außen vor, wird nur angedeutet. Und er holt damit die Lebendigkeit seiner Wahrnehmung, die Ursprünglichkeit des ersten Blicks zurück. Die Gouache bereitet vor, was im Holzrelief bzw. Holzschnitt im großen Format ausgearbeitet und farbig gefasst wird. Die Holzarbeiten sind nicht für Reproduktionsgraphiken gedacht, sondern Unikate. Doch mitunter wird einmal mit ihnen auf eine Leinwand gedruckt, sodass das Gemälde die Darstellung spiegelbildlich wiedergibt.
Gegenüber und mittendrin sieht sich so auch der Betrachter, überblickt das Häusermeer von Dehli, befindet sich vor schier unzähligen Wohnwaben von Hochhäusern, blickt in Hausschluchten, sieht sich inmitten des Modellgefängnisses, in der kalten Einsamkeit der Taiga, im zerstörten Theater von Mariupol, ist konfrontiert mit dem Hochwasser in Venedig. Und das alles nicht im abgeklärten Gegenüber einer Fotografie, sondern in der selektiv wahrnehmenden und darum so präsenten Sichtweise des Künstlers. Es gibt – wie bei der Fotografie – keine Komposition, die das Bildmotiv in sich abschließt. Es ist immer intendiert und der Darstellung immanent, dass wir das Bildmotiv gerade als Ausschnitt einer realen Situation wahrnehmen, unseren Blick aber auch weiter schweifen lassen könnten.
Emil Sorge lässt uns allein in seinen und mit seinen Orten. Die menschliche Figur tritt höchstens als Staffage auf, ist selbst nicht Thema. Um so mehr sind wir es, die wahrnehmen und agieren. Lauschige Orte sind es nicht, beunruhigend sind sie nicht auf den ersten, aber wohl auf den zweiten Blick, wenn man sich der Lebenssituationen in Millionenmetropolen oder an gefährdeten, unwirtlichen oder zerbombten Orten bewusst wird.
Der Holzbildhauer Frank Leske indessen setzt sich mit der menschlichen Figur auseinander, mit ihrer körperlichen Erscheinung, mit ihrem Habitus, bewegt und in Ruhe, bisweilen fokussiert auf die Kopfform allein. Selektiv ist auch sein Blick, sein Interesse auf das Körperhafte gerichtet. Dafür bedient Leske sich einer reduzierten, stark abstrahierenden Formensprache und Arbeitsweise. Im Kreuzschnitt bearbeitet er den Eichenstamm, von einer Seite vertikal, von der anderen horizontal. Gitterstrukturen ergeben sich, oft auch Durchblicke, als ob die Körper vom Licht durchdrungen werden. Konturen können sich klar abzeichnen oder aufgebrochen sein. Auch muldenartige Oberflächen kommen vor. Um eine realistische oder gar hyperrealistische Wiedergabe von Personen, um ein Ausarbeiten individueller Eigenheiten und Charaktere, um ein feines detailliertes Herausschnitzen von Physiognomien und Körperteilen geht es Frank Leske nicht. Sie werden auch nicht farbig gefasst, häufig aber mit Eisenoxid geschwärzt. Ein Mangel? Keineswegs. Alles zielt ab auf eine besondere Form der Wahrnehmung: Wie erfahren wir Menschen, denen wir gleichsam anonym und wie zufällig begegnen, mit denen wir kein Treffen vereinbart haben, die wir nicht näher kennen oder näher kennenlernen wollen? An was erinnern wir uns Tage, Wochen später? An ein Gegenüber zu bzw. ein Mittendrin mit Körpern. Sie sind für uns nur als menschliche Figuren, nicht als Individuen präsent, einige mit einer markanten Silhouette, manche vom Gegenlicht überblendet, lichtdurchdrungen, verunklärt, andere im Schatten verschwindend. Leskes Skulpturen tragen ihren Wert und ihre Ausdruckskraft in sich. Sie spielen nicht, handeln nicht, tragen keine Emotionen zur Schau, aber sie besetzen bestimmt ihren Platz im Licht, im Raum, im Gegenüber, mittendrin.
In dieser fragmentierenden und zugleich strukturbetonten Sicht- und Arbeitsweise erscheinen Leskes Figuren prädestiniert für ein „Gegenüber mittendrin“ mit Emil Sorges Orten – und beide Künstler regen uns damit an, über unsere Wahrnehmungen von Orten und Körpern nachzudenken.
Wahrnehmung beschränkt sich nicht auf Dingliches. Wie viele unserer Eindrücke umschreiben wir mit dem so wahren wie nebulösen und inflationär gebrauchten Wort „Stimmungen“! Oft sind es diese nicht aussprechbaren, nicht erklärbaren Stimmungen, die sich in unserer Erinnerung festsetzen. Es sind die sogenannten „Augenblicke für die Ewigkeit“, die wir auskosten, bei denen wir ganz bei uns selbst sind, bei denen es ganz still ist und die Zeit aufgehoben. Jaime Sicilia malt keine realistischen, von den Formationen her wiedererkennbare Landschaften, sondern das erhabene Erlebnis von Licht und Farbe in der Natur, Landschaftsanmutungen eingetaucht in glühendes Rot oder Gold. Er schafft den Inbegriff des ruhigen Meeres mit klarer Horizontlinie nach – rot, golden, blau, türkis. Er malt rote, türkisfarbene, gelbe Sehnsuchtsorte – Räume und Welten voll Licht, Höhe und Weite, wo unsere Gedanken frei sind und wir das unaussprechlich Schöne wahrnehmen können. „Beauty repairs“, so sagt es Jaime Sicilia. Schönheit heilt.
„Et in Arcadia ego“ ist eine Bildserie betitelt – „Auch ich war in Arkadien“. Arkadien ist seit der Antike der Inbegriff einer Idylle, einer Landschaft der Hirten, der Ruhe, der Zuneigung, der Muße. Aber wir kehren aus Arkadien zurück, wir waren in Arkadien. Es ist nunmehr ein Ort der Erinnerung und der Sehnsucht, umweht von Melancholie,
„Licht – Raum – Dimension“ ist Sicilias Ausstellung überschrieben. Ein Aspekt der Dimension, der über das Räumliche hinausgeht, ist die Zeit. Alles hat seine Zeit, jedes Erlebnis. Arkadien und auch die Schönheit sind vergänglich. Dies sollten wir wahrnehmen, bedenken und uns achtsamer verhalten. Die Serie der Amapolas, der roten Mohnblumen, macht dies deutlich.
Mohnblumen – das wissen Sie alle – eignen sich nicht als Schnittblumen, kaum gepflückt, beginnt der Prozess der Welkens. Die satte Farbigkeit weicht einer morbiden Transparenz. Sicilia hat die Blumen gepflückt, arrangiert, gepresst und in ihrem Stadium letzter Farbkraft und Schönheit in all ihrer Fragilität fotografiert. Sorgsam wurden die Aufnahmen auf Baumwollpapier gedruckt und gerahmt, dazu mit Namen berühmter Schriftstellerinnen und Romanfiguren versehen, die sich über Schönheit, Sehnsucht, Stolz und Eitelkeit äußerten. So entstand eine bemerkenswerte Sammlung, die uns auch die achtsame Wahrnehmung jedes/jeder Einzelnen lehren kann. Für Sicilia ist es die Galerie des Unvollkommenen, dem eine eigene Schönheit innewohnt.
Im Gegenüber und im Mittendrin in all dem, was sich tagtäglich ereignet, was Leben und Arbeiten mit sich bringt, was sich an Erinnerungen und Notizen auftürmt, was an Vorhaben noch vor Augen steht, ist es hin und wieder notwendig, alles zu sortieren, einen neuen Überblick zu gewinnen, sich für Künftiges vorzubereiten. Es ist notwendig, sich zu sammeln.
Patricia Schellenberger will sich sammeln, und sie will das, was sich über Jahre an Zeichnungen mit Stift, Feder oder Faden angesammelt hat, ordnen, dabei den inneren Zusammenhang der unterschiedlichen Wahrnehmungen und Vorhaben ergründen. Im Studioraum hat sie dies alles installativ ausgebreitet.
Zeichnen bedeutet für Patricia Schellenberger nicht das Abbilden von Personen, Natur oder Gegenständen. Es ist eher ein sensibles Aufnehmen und Wiedererzählen von Wahrnehmungen, von Worten, Gesprächen, Gedanken in Linien. „Jede hat ihre eigene Geschichte“ steht auf einem kleinen Blatt mit zwei kleinen Tränen. Immer wieder finden wir Sprechblasen – manche befüllt, manche leer. Immer wieder sehen wir Wesen mit Notizen. Linien formen sich zu etwas Figurenartigem, zu schriftartigen Zeichen, zu biomorphen Gebilden, zu Strudeln und zu textartigen Formationen. Sie wollen gelesen und beachtet sein, ohne etwas vorzugeben. Ein installativer Kosmos – irritierend und erheiternd zugleich – sammelt sich hier, nicht als Abschluss, sondern als Anfang für Neues.
Sich sammeln – was dabei entsteht, ist ergebnisoffen, ergibt eine von vielen Möglichkeiten. Es könnte Bestand haben oder nach und nach einiges hinzukommen oder weggenommen werden. Jetzt ist es so. Heute, vielleicht auch morgen. Es hätte auch ganz anders kommen können. Es könnte auch ganz anders werden.
Licht – Raum – Dimension.
Gegenüber mittendrin.
Sich sammeln.
Alles ist stets eine Frage der Wahrnehmung.